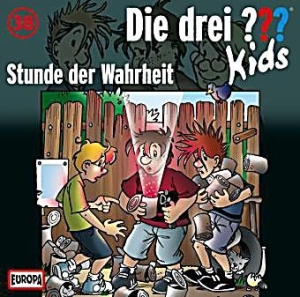Seitdem es die bildgebenden Verfahren gibt, berufen sich Psychiater zur Legitimation ihrer Wissenschaft gern auf die Befunde der modernen Hirnforschung. Tatsache ist zwar, dass mit den Methoden des “Neuroimaging” bisher noch keine Ursache der so genannten psychischen Krankheiten entdeckt werden konnte (1), aber, so wird dem staunenden Publikum versprochen, man stünde kurz vor den entscheidenden Durchbrüchen.
Die Zeitungen und die Wissenschaftsmagazine im Fernsehen stoßen in dasselbe Horn; an Berichte über sensationelle Brainscans mit bahnbrechenden Entdeckungen zu den Ursachen psychischer Krankheiten im Gehirn hat sich das interessierte Publikum inzwischen gewöhnt.
Wenn man sich davon nicht so ohne weiteres beeindrucken lassen will, sollte man sich allerdings fragen, ob der Entwicklungsstand der Neurowissenschaften zum gegenwärtigen Zeitpunkt solche “bahnbrechenden Entdeckungen” überhaupt zulässt.
Die Psychiaterin Sally Satel und der Psychologe Scott O. Lilienfeld sind dieser Frage in ihrem Buch “Brainwashed” nachgegangen (2). Satel ist nicht etwa dem antipsychiatrischen Denken zugeneigt, sondern im Gegenteil eine Gegnerin dieser Sichtweise, und auch Lilienfeld stellt die Existenz psychischer Krankheiten nicht in Frage. Dennoch gelangen die Autoren zu einem ernüchternden Fazit:
“Immer wenn eine Zeitungsschlagzeile behauptet: ‘Brainscans zeigen…’, sollte der Leser sich eines gesunden Skeptizismus’ befleißigen.”
Warum?
- Nur selten gestatten es Brainscans den Forschern zu folgern, dass Struktur X die Funktion Y verursacht. Sie zeigen bestenfalls eine Korrelation an: Ein Teil des Gehirns ist aktiv, wenn die Versuchsperson eine bestimmte Aufgabe bewältigt. Korrelationen beweisen bekanntlich aber keine Kausalität.
- Die zur Auswertung von Brainscans verwendete Substraktionstechnik setzt voraus, dass die Bedingungen für zwei mentale Aufgaben sich nur durch einen kognitiven Prozess unterscheiden. In Wirklichkeit aber sind die meisten mentalen Operationen, die wie eine einzelne Aufgabe erscheinen, aus einer Vielzahl diverser Komponenten zusammengesetzt.
- Die populäre Vorstellung, dass einzelne Regionen im Hirn für spezifische Formen des Verhaltens und Erlebens verantwortlich seien, ist eindeutig falsch. Nur in sehr seltenen Fällen sind mentale Funktionen an einem Ort im Gehirn lokalisiert.
- Die Ergebnisse der neurowissenschaftlichen Untersuchungen sind in starkem Maß von den Besonderheiten des experimentellen Designs abhängig und können häufig nicht verallgemeinert werden.
- Mit der funktionellen Magnetresonanztomographie kann man nicht etwa die Aktivität der Gehirnzellen direkt messen. Vielmehr wird der Blutfluss im Gehirn registriert. So gibt es beispielsweise eine Verzögerung von wenigstens zwei bis zu fünf Sekunden zwischen der Aktivierung eines Neurons und der Steigerung sauerstoffreichen Blutes, das zu ihm strömt. “Daher können mentale Prozesse, die im Gehirn auftreten, nicht synchronisiert sein mit der neuronalen Aktivität, die sie hervorbringt.”
- Die statistische Auswertung der Daten ist schwierig, das Procedere ist noch im Fluss und zwischen den Laboren nicht standardisiert. Die Repliktation von Ergebnissen ist daher erheblich erschwert. Außerdem wird üblicherweise eine Vielzahl von Auswertungen vorgenommen. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit sind demgemäß Scheinsignifikanzen zu erwarten, also Befunde, die nur überzufällig erscheinen, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Man kann diese Fehler zwar durch Korrekturformeln vermeiden, aber dies geschieht häufig nicht. Ein weiterer statistischer Fehler ist ebenso nicht selten: “Wenn Forscher nach Korrelationen zwischen Reizen und Hirnaktivierung schauen, werfen sie oft ein weites Netz aus. Das führt sie zunächst auf winzige Regionen mit der höchsten Aktivität. Sobald sie sich in diesen kleinen Regionen eingerichtet haben, berechnen die Forscher die Korrelationen zwischen dem fraglichen psychologischen Zustand und der Gehirnaktivierung. Indem sie dies tun, nutzen sie unvermeidlich die Zufallsfluktuationen in den Daten aus, die wahrscheinlich nicht in späteren Untersuchungen bestätigt werden.”
Die Neurowissenschaften beeindrucken durch apparativen Gigantismus, Aufwand an Arbeitskraft und Kosten. Sie sind jedoch eine verhältnismäßig junge Wissenschaft. Ihre Methoden sind alles andere als ausgereift. Bahnbrechende Erkenntnisse, die den medialen Hype unbeschadet überstehen, sind von ihr zur Zeit nicht zu erwarten.
Satel and Lilienfelds lesenswerte Arbeit steht im Übrigen nicht allein. Eine größere Zahl von einschlägig forschenden Wissenschaftlern hat sich in den letzten Jahren skeptisch zur Lage der Neurowissenschaften geäußert. So schreibt William R Uttal in seinem Buch “Mind and Brain”, dass es hier mehr Übertreibung als eine kritische Analyse, was die Experimente tatsächlich bedeuteten, zu verzeichnen gebe (3).
Mir geht es nicht darum, die neurowissenschaftliche Erforschung mentaler Prozesse zu verunglimpfen, im Gegenteil. Ich verfolge die Entwicklung in diesem Bereich als interessierter Laie mit großer Aufmerksamkeit und Sympathie. Allerdings bin ich ein an neurowissenschaftlichem Fortschritt interessierter Laie. Und daher missbillige ich entschieden Verstöße gegen die grundlegenden Prinzipien der Wissenschaftlichkeit. Dass diese von den Medien missachtet werden, mag man achselzuckend hinnehmen. Forschern aber lasse ich dies nicht durchgehen. Es ist intellektuell unredlich.
Aufgrund des neurowissenschaftlichen Hypes ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, die Psychiatrie sei eine medizinische Disziplin auf neurowissenschaftlicher Grundlage. Dieser Eindruck ist noch nicht einmal annähernd richtig. In der psychiatrischen Praxis spielen daher die Brainscans auch keine Rolle. Das National Institute of Mental Health, das weltweit größte psychiatrische Forschungszeitrum, das am Neuro-Hype in den Medien nicht ganz unschuldig ist, räumt auf einer Web-Seite unumwunden ein:
“Was Brainscans nicht können
- für sich genommen psychische Krankheiten diagnostizieren
- das Risiko, eine psychische Krankheit zu bekommen, vorhersagen.”
Allenfalls bei einer kleinen Zahl von Krankheiten, heißt es weiter, könnten Brainscans Diagnosen bestätigen, wie beispielsweise bei Hirntumoren. Wie eingangs betont, konnten aber bei keiner der so genannten psychischen Krankheiten Veränderungen des Hirns als ursächlich diagnostiziert werden und daher taugen Brainscans auch nicht zur Diagnose dieser angeblichen Krankheiten.
Getreu der alten Weisheit, dass ein Bild mehr sage als tausend Worte, nutzt die Psychiatrie die suggestive Macht der bunten Brainscans für ihr Marketing. Dies ist natürlich legitim, denn die Psychiatrie ist ein Wirtschaftszweig wie jeder andere auch und zum Wirtschaften gehört, zumindest im Kapitalismus, das Marketing dazu. Es ist ein Teil des unternehmerischen Gesamtprozesses.
Wer die Psychiatrie für einen legitimen Zweig der Heilkunde hält und wer ein naives Verständnis der Medizin hat, den wird es schaudern bei der Vorstellung, dass seine Gesundheit Gegenstand des Marketings ist. Der damit verbundene Stress sollte aber niemand dazu verführen, das kritische Denken einzuschränken.
Fakt ist, dass die heutige Psychiatrie weder Brainscans für ihre Arbeit nutzen kann, noch über sonstige halbwegs exakte Methoden verfügt. Dies liegt daran, dass weder ihre Diagnosen, noch ihre sonstigen Konstrukte valide sind. Man nehme als Beispiel den Begriff der “Halluzination”. Hierzu heißt es im “Lehrbuch Psychiatrie” von Andreasen und Black (4):
“Wenn die Halluzinationen von religiöser Natur sind, sollten diese danach beurteilt werden, was innerhalb des sozialen und kulturellen Hintergrunds des Patienten normal ist.”
Dies ist eine Ermessensfrage, nichts, was sich im Rahmen eines validen Konstrukts operationalisieren ließe. Wir werden auch auf Brainscans niemals erkennen können, ob jemand, gemessen an seinem sozialen und kulturellen Hintergrund, normal halluziniert.
In seinem Buch “Hallucinations” (5) wies der Neurologe Oliver Sacks nach, dass Halluzinationen durch viele unterschiedliche Prozesse im Nervensystem ausgelöst werden können und keineswegs ein alleiniges Charakteristikum der “Schizophrenie” sind. Über den Unterschied des Stimmenhörens bei “Schizophrenen” und bei “Normalen” schreibt er:
“Die Stimmen, die manchmal von Leuten mit Schizophrenie gehört werden, tendieren dazu, anklagend, bedrohlich, höhnisch oder verfolgend zu sein. Im Gegensatz dazu, sind die von den ‘Normalen’ halluzinierten Stimmen ziemlich wenig bemerkenswert…”.
Und weiter:
“Es ist klar, dass die Einstellungen zum Stimmenhören eine kritische Bedeutung besitzen.”
Mir ist kein Brainscan bekannt, der irgendeinen Unterschied zwischen den Halluzinationen von “Schizophrenen” oder “Normalen” unter Beweis stellen würde. Dennoch sind die mentalen Prozesse, in die das Stimmenhören eingebettet ist, doch offenbar sehr unterschiedlich und in entscheidender Weise abhängig von Einstellungen. Einstellungen aber sind das Ergebnis von Lernprozessen unterschiedlichster Art; ihnen liegt mit Sicherheit kein fixes Muster neuronaler Aktivität zugrunde.
Brainscans sind heute gleichsam das heilige Symbol der Validität des medizinischen Modells “psychischer Krankheiten”. Doch ihre Symbolkraft beruht auf einer profanen Fehleinschätzung, deren Wurzeln im Reich des Wunschdenkens, der Eitelkeit und des Eigeninteresses zu suchen sind.
Anmerkungen
(1) Borgwardt, S. et al. (2012). Why are psychiatric imaging methods clinically unreliable? Conclusions and practical guidelines for authors, editors and reviewers. Behavioral and Brain Functions, 8:46
(2) Satel, S. & Lilienfeld, S. O. (2013). Brainwashed. The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience. New York, N. Y.: Basic Books
(3) Uttal, W. R. (2011). Mind and Brain. A Critical Appraisal of Cognitive Neuroscience. Cambridge: MIT Press
(4) Andreasen, N. C. & Black, D. W. (1993). Lehrbuch Psychiatrie. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union, Seite 41
(5) Sacks, O. (2012). Hallucinations. New York, N. Y.: Knopf
The post Brainscans appeared first on Pflasterritzenflora.