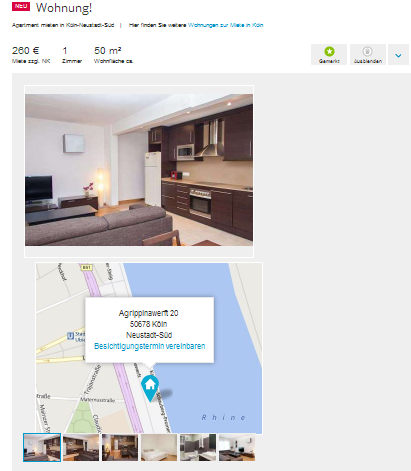Autismus gilt als angeborene, unheilbare Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung, die sich im frühen Kindheitsalter bemerkbar macht. Er wird von der Psychiatrie als psychische Krankheit aufgefasst. Um dieses Konstrukt zu validieren, wurde versucht, die hirnphysiologischen Grundlagen dieser “Krankheit” zu identifizieren. Die Befunde bisher können nur als chaotisch bezeichnet werden.
So meinten beispielsweise Gilbert und seine Mitarbeiter, gestützt auf eine Untersuchung mit dem bildgebenden Verfahren fMRI, dass die Ursache des Autismus in der Hyperaktivität der Frontallappen und möglicherweise zudem der Zerebralen Pole und des Mandelkerns liege (1). Luna und seine Mitarbeiter fanden allerdings, mit demselben Verfahren, bei Autisten eine gegenüber Normalen geringere Aktivierung im dorsolateralen präfrontalen Kortex, einem Teil des Frontallappens (2).
Diese beiden offensichtlich widersprüchlichen Studien zu den Ursachen des Autismus sind nicht etwa Ausnahmen, sondern die Regel, die sich durch den gesamten Korpus einschlägiger Forschungen zieht. Zu Recht schreibt Thomas Insel, der Direktor des National Institute of Mental Health (NIMH) in seinem “Director’s Blog“:
“In 2014, the mystery of autism remains largely unsolved. We describe autism as a neurodevelopmental disorder, but … we do not know precisely how to define what the brain disorder is or when it occurs.”
Auch im Jahr 2014, also mehr als 70 Jahre nach ihrer Erfindung, bleibt diese “Krankheit” ein Rätsel für die Psychiatrie. Es gibt im Übrigen auch kein effektives Medikament zur Behandlung dieser “Krankheit” und alle verhaltensorientierten Therapieformen sind gleichermaßen effektiv (was darauf schließen lässt, dass die jeweilige Methode keine Rolle spielt) (3). Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich gibt es die Phänomene, die von der Psychiatrie als “Symptome” des Autismus gedeutet werden. Der Beweis dafür, dass diese Deutung den Tatsachen entspricht, steht allerdings noch aus.
Gern werden die Gene für Autismus verantwortlich gemacht; man wähnt, dies durch Zwillingsstudien erhärten zu können, über deren methodische Fragwürdigkeit beispielsweise Jay Joseph (5) informiert. Tatsache ist im Übrigen, dass es bisher noch nicht gelungen ist, Gene zu identifizieren, die Autismus verursachen (4). Entgegen anders lautenden Gerüchten konnte also noch nicht der Nachweis erbracht werden, dass es sich beim Autismus um eine angeborene Krankheit handelt.
Beim Autismus zeigt sich also das aus der psychiatrischen Krankheitslehre allgemein bekannte Bild: Es können weder Hirnstörungen, noch Gene als Ursachen dieser mutmaßlichen Krankheit erhärtet werden.
Angeblich soll es Hinweise darauf geben, dass die Spiegelneurone bei Menschen mit Autismus nicht richtig funktionieren (6). Dies ist schon erstaunlich, da bisher noch nicht einmal zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass diese Form der Nervenzellen beim Menschen tatsächlich existiert und erst recht weiß man nicht, welche Funktion, falls es sie geben sollte, sie im menschlichen Nervensystem erfüllen (7). Wir haben es hier also gleichsam mit einer Quadratur der Spekulation zu tun.
Angesichts des skizzierten Forschungsstandes verwundert es nicht, dass es kein objektives diagnostisches Verfahren gibt, mit dem man das Vorhandensein eines Autismus feststellen könnte. Laut Wikipedia muss ein mutmaßlich Betroffener von einer “Autism Spectrum Disorder” nach den neuesten diagnostischen Manualen (DSM-5; ICD-11) aus allen drei Bereichen des Gebiets 1 ein Kriterium und aus dem Gebiet 2 zwei Kriterien erfüllen:
Gebiet 1: soziale Kommunikation
- 1A: merkwürdige Kontaktaufnahme ODER Unfähigkeit, Gespräche aufrecht zu erhalten ODER keine Gespräche starten
- 1B: kaum Verwendung von Mimik/Gestik ODER Auffälligkeiten bei Blickkontakt ODER Defiziten beim Verständnis nonverbaler Kommunikation
- 1C: Defizite bei der Aufnahme und Aufrechterhaltung von Beziehungen
Gebiet 2: Stereotypien/Rituale
- 2A: Stereotypien ODER repetitive Bewegungen ODER Echolalie
- 2B: Routine
- 2C: Spezialinteresse
- 2D: Hyper- bzw. Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder andere Reize
Hier handelt es sich offensichtlich nicht um harte Kriterien, sondern vielmehr ausschließlich um Ermessensfragen. Die neuen Klassifikationssysteme schreiben die Nebelhaftigkeit ihrer Vorgängerversionen nur fort. Es fragt sich, welchen Nutzen diese Revisionen den Klinikern und Forschern bringen sollen. Selbst wenn es so etwas wie die Krankheit “Autismus” geben sollte, so könnte man vermutlich in einer dermaßen wild zusammengewürfelten Gruppe angeblich Betroffener keine gemeinsamen hirnphysiologischen oder genetischen Merkmale entdecken.
Natürlich lässt sich die Pharmaindustrie durch derlei Schwierigkeiten und Hindernisse auf dem Weg zur Erkenntnis nicht bremsen. In einer Pressemeldung aus dem Jahre 2012 heißt es unter dem Titel: “Berg Pharma Companies Present Groundbreaking Approach to Understanding Autism and Identify Novel Biomarkers That May be Crucial in Diagnosis“:
“‘We look forward to further validation of these novel findings in an effort to support more definitive diagnoses and patient stratification in autism‘, said Rangaprasad Sarangarajan, Sr. VP and CSO of Berg Pharma.”
Da blickt man also hoffnungsfroh einer weiteren Validierung von Befunden entgegen, deren Fragwürdigkeit angesichts des vorhandenen und gut dokumentierten Forschungsstandes nicht begründet werden muss. Meine Recherchen im Internet erbrachten keine neueren Informationen zu diesem Projekt von Berg Pharma. Jedenfalls wünsche ich diesen Forschern viel Glück bei ihrem edlen Bestreben, neue Wege zur Behandlung des Autismus zu erschließen.
Bis zum Beweis des Gegenteils kann ich mich allerdings sehr gut mit der Meinung Colin Müllers, eines Autors der Website Autismus-Kultur identifizieren:
“Autismus ist nicht
heilbar, weil:
- Autismus keine
Krankheitist.- Selbst wenn Autismus eine Krankheit wäre, gäbe es (auf absehbare Zeit) kein Verfahren, Autismus
verschwinden zu lassen.- Selbst wenn dies möglich wäre, würden die meisten Menschen im Autismus-Spektrum überhaupt nicht
geheiltwerden wollen, weil Autismus ein inhärenter Teil ihrer Persönlichkeit ist und eine ‘Heilung’ von Autismus die Auslöschung ihrer Persönlichkeit bedeuten würde.”
Inzwischen hat sich Wundersames getan. Eine psychiatrische Diagnose, die im Allgemeinen als Jobkiller gilt, wird zur Vorausstellung für die Einstellung in der Software-Branche. Der Software-Gigant SAP will bis 2020 ein ehrgeiziges Ziel erreichen: Ein Prozent seiner Mitarbeiter sollen Autisten sein. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen mit Specialisterne zusammen, einer Organisation, die Autisten in Arbeit und Brot bringen will. Auf der Website von Specialisterne heißt es:
Für die Bewerbung an einem der Standorte gibt es folgende Voraussetzungen:
- Sie verfügen über eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum.
- Sie wohnen in der Nähe oder Umgebung einer der Pilot-Standorte und können daher täglich zur Arbeit pendeln, oder
- Sie sind imstande eigenständig umzuziehen, falls ein Arbeitsvertrag zustande kommt.
- Sie haben auf privater oder beruflicher Basis IT-/Computerkenntnisse erlangt, oder haben anderweitig einen starken Bezug zu Computern/IT.
- Sie können Englisch lesen, schreiben und sprechen (Relevanz in dieser Reihenfolge).
- Sie sind zum Zeitpunkt der Bewerbung volljährig.
Angesichts der Tatsache, dass derartige Diagnosen willkürlich sind, also vom Gutdünken des Diagnostikers abhängen, sollte es für einen ordentlichen EDV-Freak nicht schwierig sein, seine Arbeitsmarktchancen durch eine entsprechende Diagnose zu verbessern. Autismus als “Unique Selling Proposition” – das hat was.
Anmerkungen
(1) Gilbert, S. et al. (2008). Atypical recriutment of medial prefrontal cortex in autism spectrum disorder. An fMRI study of two executive function tasks. Neuropsychologica, 46, 2281-2291
(2) Luna, B. et al,. (2002). Neocortical system abnormalities in autism: An fMRI study of spatioal working memory. Neurology, 59, 834-840
(3) Thompson, T. (2007). Making sense of autism. Baltimore: Paul A. Brooks Publishing Co.
(4) Miles, J. H. (2011). Autism spectrum disorders—A genetics review. Genetics in Medicine, 13, 278–294
(5) Joseph, J. (2012). The “Missing Heritability” of Psychiatric Disorders: Elusive Genes or Non-Existent Genes?Applied Developmental Science, 16, 65-83
(6) Dapretto, M. et al. (2005). Understanding emotions in others: mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders. Nature Neuroscience, 4. Dezember
(7) Pflasterritzenflora: Spiegelneurone
The post Autismus appeared first on Pflasterritzenflora.