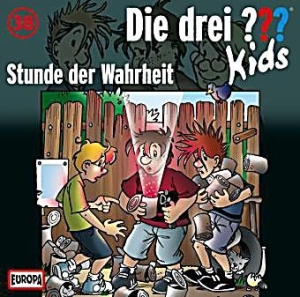Der Anarchismus zeichnet sich gegenüber anderen politischen Bewegungen dadurch aus, dass er sich nicht in ein geistiges Korsett pressen lässt. Es fragt sich sogar, ob er als politische Bewegung definiert werden kann, denn wenn Politik Herrschaft des Menschen über den Menschen ist oder damit beginnt, die Menschen in Freund und Feind zu unterteilen, dann ist Anarchismus keine Politik.
Wer sich als Anarchist bezeichnet, fühlt sich allerdings zumeist einer Reihe grundlegender Ideen verpflichtet. Diese Ideen lassen sich am besten als Polaritäten darstellen, wobei der Anarchist jeweils dem zuerst genannten Pol zuneigt (wenngleich es dem Wesen des Anarchismus entspricht, dass dies nicht für jeden Anarchisten bei jedem Punkt zutrifft):
- selbstbestimmte kleine Einheiten – staatliche bzw. megastaatliche Organisation
- Heterarchie – Hierarchie
- natürliche Autorität – institutionalisierte, formale Autorität
- soziale, verantwortete Freiheit - individuelle, schrankenlose Freiheit
- gegenseitige Hilfe – allseitige Konkurrenz
- Freiwilligkeit – Befehl und Gehorsam (1)
Die anarchistische Botschaft richtet sich nicht an die Massen, und daher ist sie auch nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den Horizont der Massen und auf den Massengeschmack zugeschnitten. Ihr Adressat ist vielmehr das Individuum, das sich, gleichberechtigt und ggf. in Kooperation mit anderen selbst verwirklichen möchte. Die Mission des Anarchismus lautet: Kritik und Überwindung jeder sachlich nicht gerechtfertigten Herrschaft des Menschen über den Menschen und beständiger Kampf zur Vergrößerung des Spielraums, der dem freien Willen des Einzelnen zu seiner Entfaltung eingeräumt wird.
Um die anarchistische Utopie zu verwirklichen, müssen allerdings nicht nur die äußeren Verhältnisse umgewälzt werden (2). Denn dieser Traum kann nur mit innerlich freien Menschen Realität werden. Und hier kommt die Psychologie ins Spiel. Das Verhältnis zwischen Anarchismus und Psychologie ist von unterschiedlichen anarchistischen Autoren in unterschiedlichster Weise bestimmt worden; und, der anarchistischen Grundhaltung entsprechend, beanspruche ich für meine folgenden Überlegungen keine Allgemeinverbindlichkeit.
Es gilt, den Staat im Kopf zu überwinden. Damit meine ich nicht in erster Linie den Glauben an die unbedingte Notwendigkeit des Staates, den es natürlich ebenso abzustreifen gilt. Damit meine ich die staatsartige Struktur unseres mentalen Lebens. Dass der Staat nicht naturgegeben ist, lässt sich den meisten Menschen relativ leicht vermitteln, wenn man sie darauf hinweist, dass die Menschheit im “Urzustand” keine Staaten kannte, sondern in Kleingruppen umherstreifte. Schwieriger ist es, den Menschen klarzumachen, dass sie Fremdherrschaft auch dort dulden, wo sie im Prinzip einfach abzustreifen wäre, nämlich in ihrer Innenwelt.
Das Gewissen ist naturgegeben. Das Ich fragt nach dem Du, fragt danach, wie seine Handlungen sich auf andere auswirken und ist geneigt, schädigende Effekte nach Möglichkeit zu vermindern. Ohne diese Tendenz gäbe es die Menschheit nicht. Mit der Entwicklung äußerer Herrschaft des Menschen über den Menschen denaturierte das Gewissen jedoch zur Moral. Die Moral gibt sich den Anschein, Gewissen zu sein, ist in Wirklichkeit aber etwas ganz anderes, nämlich der verinnerlichte Widerschein des Prinzips von Befehl und Gehorsam, das die hierarchischen Gesellschaften prägt.
Ebenso wie der Befehlsgeber in der Außenwelt bedingungslosen Gehorsam erwartet, so dürfen die Gebote und Verbote der Moral nicht in Frage gestellt werden. Selbstredend sprechen Befehlsgeber in demokratischen Gesellschaften davon, dass der mündige Bürger Befehle auf Angemessenheit prüfen solle und die sie flankierenden Wissenschaftler betrachten es als moralische Reife, wenn man ihren Geboten und Verboten aus Einsicht folgt. Dennoch, es bleibt dabei, jenseits der Verklärung geht es schlicht und ergreifend darum, Automatismen durchzusetzen, in der Außenwelt, wie in der Innenwelt. Befehl und Gehorsam. Das war’s.
Es versteht sich von selbst, dass die Moral unterm Strich überwiegend den Interessen der Herrschenden dient. Zwar schützt sie durchaus auch, wie das Gewissen, den Mitmenschen ohne Ansehen der Person; aber letztlich steht das, was sich gehört und was sich nicht gehört, stets im Einklang mit den Erfordernissen zur Aufrechterhaltung einer ausbeuterischen gesellschaftlichen Ordnung.
- Wir sollen ehrlich sein, klar, aber diese Ehrlichkeit schützt auch den Unternehmer, der seine Mitarbeiter auspresst.
- Wir sollen wahrhaftig sein, aber von dieser Wahrhaftigkeit profitieren auch die Leute, die uns schamlos belügen.
- Wir sollen gerecht sein, doch diese Gerechtigkeit wird auch Leuten zuteil, die sie mit Füßen treten.
- Wir sollen Toleranz üben, aber dies heißt auch, Intoleranz zu tolerieren.
- Wir sollen hilfsbereit sein, auch gegenüber Leuten, die anderen keinerlei Hilfe gewähren.
- Wir sollen patriotisch sein, obwohl das Vaterland von Leuten beherrscht wird, die ihr Volk vergessen haben.
Man könnte diese Liste beliebig verlängern und würde feststellen, dass die Bedingungslosigkeit der Moral sich letztlich für am meisten bezahlt macht, die in einer hierarchischen Gesellschaft am längeren Hebel sitzen.
Die Moral ist der generalisierte Herrscher im Kopf, der internalisierte Staatsapparat. Während das Gewissen konkret nach dem Du fragt, gießt die Moral ihre Segnungen nach dem Gießkannenprinzip aus; und dies führt dazu, dass die ohnehin Begünstigten am besten gedeihen.
Viele meinen, das Ich sei eine Art Diplomat, der zwischen den Anforderungen der Realität, den Forderungen der Moral und den anarchischen Trieben des Es zu vermitteln habe. Sie glauben, dass dies der naturgegebenen Ordnung in unserer Innenwelt entspräche.
Dies halte ich für falsch. Aus meiner Sicht stand in den frühen Stammesgesellschaften, in denen der Einzelne auf Gedeih und Verderb auf die Solidarität seiner Stammesgeschwister angewiesen war, das Wir an der Stelle des Ichs. Da sich die Moral noch nicht an die Stelle des Gewissens gedrängt hatte, mussten ihre Forderungen auch nicht beachtet werden; und die Gleichrangigkeit von Ich und Du ist im Wir aufgehoben. Die anarchischen Triebe mussten nicht gefürchtet werden, weil die Organisation des Gemeinschaftslebens anarchisch war.
Unser Gewissen gebietet es uns, natürliche Autorität anzuerkennen, wohingegen die Moral verlangt, uns formaler Autorität zu unterwerfen.
- Letzterer beugt man sich aus moralischen Gründen, weil dies die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung gebietet.
- Ersterer unterstellt man sich, um nicht durch unbedachtes Handeln andere (bzw. sich selbst) zu schädigen.
Die Bedingungslosigkeit der Moral zwingt uns dazu, uns auch dann institutionalisierter Autorität zu unterwerfen, wenn diese ihre Vorrangigkeit nicht sachlich zu rechtfertigen vermag.
In der hierarchischen Gesellschaft darf sich, in gewissen, mehr oder weniger weiten Grenzen, das Individuum auch auf Kosten anderer entfalten. Davon profitieren die ohnehin schon Begünstigten, weil im Konkurrenzkampf jener die stärkere Postion hat, der über die meisten Ressourcen verfügt.
In den Köpfen der meisten Menschen hat sich die Überzeugung festgesetzt, dass die Erfolgreichen die natürlich Begabten seien und dass es deswegen ungerecht und kontraproduktiv sei, den Talentierten übermäßige Beschränkungen aufzuerlegen. Viele meinen, dass es ein Naturrecht des Stärkeren, des Leistungsfähigeren, des Kreativieren gäbe, sich gegen die Schwächeren, weniger Leistungsfähigen und Dumpfen durchzusetzen.
Es handelt sich bei diesem Glauben aber keineswegs um eine Haltung, die von der Natur in unsere Hirne eingesenkt wurde. Sie war den frühen Stammesgesellschaften fremd, wie sich auch an den Einstellungen von Menschen, die bis tief ins 20. Jahrhundert hinein noch auf steinzeitlichem Niveau lebten, zeigte.
Freiheit, die Einzelnen ermöglicht, anderen ihre Freiheit zu rauben, führt sich selbst ad absurdum. Diese schrankenlose Freiheit ist nicht etwa der Garant einer natürlichen, sondern sie führt im Gegenteil zu einer widernatürlichen Ordnung, zur Klassengesellschaft, die der Mensch in seinem “Urzustand” nicht kannte.
Bereits betont habe ich, dass sich in Klassengesellschaften die Vorstellung durchgesetzt hat, das mentale Leben würde durch ein diplomatisches Ich reguliert, das widerstrebende Interessen auszugleichen habe. Dies ist jedoch eine unvollständige Beschreibung. Hinzu kommt, dass dieses Ich auf seinen Vorteil bedacht sein müsse, was dazu führt, dass Heuchelei und Scheinmoral in Grenzen toleriert werden.
Diese Vorstellung ruft den Eindruck hervor, dass der Konkurrenzkampf unter den Menschen ein Charakteristikum des Naturzustandes sei. Dieser war jedoch im Gegenteil durch die Vorherrschaft des Wir und des Gewissens gekennzeichnet. Darum spielte die gegenseitige Hilfe in den Stammesgesellschaften die ausschlaggebende Rolle.
Die letzte Bastion von Menschen, die Staatlichkeit anthropologisieren, ist die Rolle des Häuptlings in den frühen Stammesgesellschaften. Anführer, die das Sagen haben, hätte es schon immer gegeben, und der Staat sei nichts weiter als eine natürliche Weiterentwicklung des Prinzips von Befehl und Gehorsam.
Weit gefehlt. Die Autorität des Häuptlings war eine natürliche, keine formale. Er musste seine Überlegenheit, seine Stärke und Weisheit, im tagtäglichen Überlebenskampf des Stammes unter Beweis stellen. Seine Gefolgsleute folgten ihm freiwillig, er hatte keine Leibgarde, die ihn vor Absetzung schützte.
Die vorangestellten Überlegungen erheben nicht den Anspruch ewiger Wahrheit; vielmehr sind sie als Skizze eines Forschungsprogramms der anarchistischen Psychologie zu verstehen. Ich bin schon zu alt und nicht mit den Mitteln und Gaben ausgestattet, um ein solches Forschungsprogramm voranzutreiben. Wenn einmal die Zeit kommen sollte, dass begabte mutige Frauen und Männer es mit Aussicht auf Erfolg in Angriff nehmen können, dann wünschte ich mir eine stringente empirische Ausrichtung dieses Unterfangens. Die empirische Wissenschaft ist antiautoritär: Es zählen die Fakten, nicht die Lehrmeinungen.
Vielleicht täusche ich mich ja, vielleicht ist es unausweichlich, dass immer irgendwelche Eliten über die Massen herrschen. Doch ich glaube nicht daran. Meine Hoffnung nährt sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Autonomie des Menschen, die uns bereits vorliegen. Die Forschungen zur Irrationalität menschlicher Entscheidungen beispielsweise zeigen immer auch, dass der Mensch diese Neigung unter bestimmten Voraussetzungen durchbrechen kann. Warum versuchen wir nicht, diese Voraussetzungen zu schaffen?
PS: Es wird dem Leser vermutlich aufgefallen sein, dass ich bisher dem Eigentum keine Zeile gewidmet habe. Dies liegt daran, dass diese Frage für den Anarchisten eine eher untergeordnete Rolle spielt. Während Marxisten und Kapitalisten von der Eigentumsfrage nachgerade besessen sind, habe Anarchisten dazu eine pragmatische Einstellung. Eigentum ist zweifellos eine Voraussetzung der Freiheit, aber nicht jedes Eigentum macht frei. Dass selbst genutzte Produktionsmittel ihren Anwendern gehören sollten, steht außer Frage. Wenn mehrere Menschen miteinander kooperieren, liegt es nahe, die dazu benötigten Produktionsmittel als Eigentum des produzierenden Kollektivs aufzufassen. Einrichtungen wie beispielsweise Straßen oder die Häuser der Räte, die allen dienen, sollten auch Gemeinschaftseigentum sein. Es sind immer Ausnahmen von der Regel denkbar, und darüber zu befinden, obliegt den unmittelbar und teilweise auch den mittelbar Betroffenen, die dazu einen Konsens anstreben sollten.
Anmerkungen
(1) Diese Liste erhebt, wie alle meine Listen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
(2) Ein Anarchist wird die Anwendung von Gewalt nur im äußersten Notfall (Widerstandsrecht) akzeptieren, weil ihm die Herrschaft des Menschen über den Menschen ein Gräuel ist.
The post Anarchismus und Psychologie appeared first on Pflasterritzenflora.