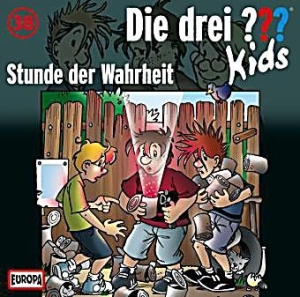H. Christian Fibiger ist kein Unbekannter in der Welt der Psychopharmakologie. Der Chemiker und Psychologe ist heute “Chief Scientific Officer” bei MedGenesis Therapeutix. Zuvor nahm er leitende Funktionen u. a. bei Biovail Laboratories International, Amgen und Eli Lilly wahr. Außerdem war er Professor and Leiter der Abteilung für Neurologische Wissenschaften sowie Vorsitzender des Graduiertenprogramms für Neurowissenschaften der Universität von British Columbia in Vancouver, Kanada.
Wenn ein Mann wie Prof. Fibiger einen Aufsatz in einer international respektierten Fachzeitschrift erscheinen lässt, der mit dem Satz beginnt: “Die Psychopharmakologie ist in der Krise”, dann werden Psychiatrie- und Pharmaindustrie-Kritiker gleichermaßen hellhörig. Schließlich ist der Mann in wirtschaftlicher und in wissenschaftlicher Hinsicht ein Insider. Der Titel seines Aufsatzes, der im Schizophrenia Bulletin (vol. 38 no. 4 pp. 649–650, 2012) erschien, klingt noch vergleichsweise harmlos: “Psychiatry, The Pharmaceutical Industry, and The Road to Better Therapeutics.” So ähnlich klingen viele Überschriften von Aufsätzen, in denen die Interessen des Marketings und der Wissenschaft eine makellose Synthese eingehen.
Nachdem er die Krise konstatiert hat, folgt im zweiten Satz die Begründung: “Die Daten sind da, und es ist klar, dass ein gewaltiges Experiment gescheitert ist.” Obwohl über Jahrzehnte geforscht und Milliarden ausgegeben wurden, konnte in den letzten dreißig Jahren nicht ein einziges, hinsichtlich des Wirkmechanismus’ neues Medikament in den psychiatrischen Pharma-Markt eingeführt werden. Aus diesem Grunde hätten fast alle bedeutenden Hersteller von Psychopharmaka die Suche nach solchen Substanzen entweder eingestellt oder die Mittel dafür stark reduziert. Verständlich, weil andere Bereiche profitabler erscheinen: Krebs und Immunologie beispielsweise. Dorthin werden nun die Forschungsmittel kanalisiert.
Das Erstaunlichste sei, schreibt Fibiger, dass sich die Industrie nicht schon viel früher aus diesem Bereich zurückgezogen habe. Hier seien nämlich keine Erfolge im Feld der Psychopharmakologie mehr zu erwarten, solange die Psychiatrie keine grundlegenden Fortschritte mache.
“What the field lacks is sufficient basic knowledge about normal brain function and how its disturbance underlies the pathophysiology of psychiatric disease.”
Der Psychiatrie fehlt ein hinlängliches Basiswissen darüber, wie das normale Gehirn funktioniert und in welcher Weise Hirnfunktionsstörungen der “Pathophysiologie psychiatrischer Krankheiten” zugrunde liegen.
Dies wirft im Übrigen, am Rande bemerkt, ein bezeichnendes Licht auf die Frage, ob man zu recht von “psychischen Krankheiten” sprechen darf. Denn wie will man etwas als krank bezeichnen, wenn man nicht weiß, was gesund ist? Man brauchte ein Modell der natürlichen, ungestörten Funktionsweise des Gehirns; doch von einem solchen Modell sind die Neurowissenschaften Lichtjahre entfernt. Sie wissen noch nicht einmal, welche Fragen sie hierzu stellen sollten, geschweige denn sind Antworten in Sicht.
Ein entscheidendes Hindernis des Fortschritts der psychiatrischen Wissenschaft sei der der augenblickliche Zustand der Nosologie, also der Klassifikation “psychischer Krankheiten”.
“Today, few would argue that syndromes such as schizophrenia and depression are single, homogeneous diseases. And yet when it comes to clinical research, including clinical trials, both are still almost always treated as such. For example, studies continue to be published on the genetics of both of these syndromes despite the fact that there never will be a robust genetics of either condition as the nature and severity of specific symptoms are too heterogeneous across individuals to have any consistent genetic correlates. Similarly, while DSM conceptualizations of psychiatric disease may have utility in current clinical practice, when it comes to research, they too are a barrier to progress.”
Nur wenige Fachleute, meint Fibiger, würden heute noch behaupten, dass Schizophrenie oder Depression einzelne, homogene Krankheiten seien. Doch in der Forschung, auch in klinischen Tests, würden sie so behandelt, als wären sie es. So würden immer noch Studien zur genetischen Basis dieser beiden Störungen publiziert. Tatsache sei jedoch: Die Menschen mit diesen Diagnosen sind viel zu unterschiedlich, als dass man jemals eine gemeinsame, robuste Konfiguration von Genen bei ihnen finden könnte. Auch wenn die Konstrukte des DSM, also des Diagnoseschemas der amerikanischen Psychiatrie, sich in der Praxis als hilfreich erweisen sollten, seien sie in der Forschung eine Barriere des Fortschritts.
Dies schreibt nicht irgendwer, dies schreibt kein ewig nörgelnder Pharmakritiker und auch kein Aktivist der Antipsychiatrie, sondern ein reichlich mit namhaften Preisen bedachter Neurowissenschaftler, Psychopharmakologe und eine Führungspersönlichkeit der Pharmaindustrie.
Fibiger meint, dass man die psychiatrischen Diagnosen in einzelne Komponenten zerlegen und dann nach den neurophysiologischen Korrelaten dieser Aspekte menschlichen Verhaltens und Erlebens suchen sollte. Man dürfe nicht erwarten, eine einheitliche Grundlage für Schizophrenie zu finden, aber man dürfe sich Hoffnung machen, die neurophysiologische Basis von Halluzinationen, Wahnvorstellungen u. ä. zu entdecken.
“Given that there cannot be a coherent biology for syndromes as heterogeneous as schizophrenia, it is not surprising that the field has failed to validate distinct molecular targets for the purpose of developing mechanistically novel therapeutics. Although it has taken our field too long to gain this insight, we seem to be getting there.”
Nun ist die Katze aus dem Sack. Es kann beispielsweise gar keine einheitliche Grundlage für eine so heterogene Störung wie die Schizophrenie geben. Daher ist es nicht überraschend, schreibt Fibiger, dass die Forschung mit ihrem Versuch scheiterte, abgegrenzte molekulare Ziele für Medikamente mit neuen Wirkmechanismen zu finden.
Man kann sicher nicht, wenn man weiterhin als bei Trost gelten möchte, die Existenz der Phänomene bestreiten, die von der Psychiatrie als “Symptome einer psychischen Krankheit” gedeutet werden. Wohl aber, und mit guten Gründen, darf man bezweifeln, dass es sich bei diesen Phänomenen um Krankheiten handelt.
Die psychiatrische Diagnostik, schreibt James Davies in seinem Buch “Cracked. Why Psychiatry Is Doing More Harm Than Good”, gleiche in ihrem gegenwärtigen Zustand den Sternbildern. Die Sterne gebe es ja durchaus, aber die Sternbilder seien willkürliche Verbindungslinien zwischen ihnen.
Fibiger begrüßt es, dass – eingedenk dieser Erkenntnisse – das National Institute of Mental Health (NIMH) der Vereinigten Staaten ein Forschungsprogramm gestartet hat, das die Kriterien des DSM vollständig ignorieren wird. (Am Rande sei bemerkt, das natürlich das in Deutschland gebräuchliche Diagnose-Schema ICD dieselben Probleme aufweist wie das DSM.) Unter dem Titel “Research Domain Criteria” (RDoC) wird das NIMH das vorhandene Wissen über normale Funktionsweisen des Gehirns zum Ausgangspunkt der Forschung machen.
“RDoC begins with current knowledge of brain circuits underlying specific domains of normal behavior and subsequently attempts to link them to clinical phenomena. Going forward, it will be fascinating to see how psychosis, including hallucinations, delusions, and thought disorder are addressed in the RDoC framework.”
Das RDoC ist die große Hoffnung der Psychiatrie und Psychopharmakologie, zumindest jener Vertreter dieser Disziplinen, die wissen, das sie ein erhebliches Problem haben. Das erhebliche Problem lässt sich auf folgende Formel bringen: Obwohl die Psychiatrie psychische Störungen wie Schizophrenie oder Depression als Krankheiten behandelt, die angeblich auf (weitgehend angeborenen) Störungen des Gehirns beruhen, befindet sie sich die psychiatrische Forschung diesbezüglich bisher auf dem Holzweg.
Wir müssen abwarten, ob RDoC nun die ersehnten Erfolge bringen oder ob sich dieses Projekt ebenfalls als Holzweg erweisen wird. Ich begrüße dieses Forschungsprogramm mit großem Nachdruck. Wenn es tatsächlich biologische Ursachen psychischer Krankheiten geben sollte, dann wäre es natürlich gut, so viel wie möglich über sie und über Heilungsmöglichkeiten zu erfahren. Allerdings wünsche ich den Verantwortlichen für dieses Projekt auch die Weisheit zu erkennen, wann man ein Forschungsprogramm als gescheitert betrachten muss und aufgeben sollte. Dass ist nach Imre Lakatos, dem bedeutenden Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker, dann der Fall, wenn sich ein besseres Forschungsprogramm entwickelt, das mehr zutreffende Vorhersagen machen kann. Zur Pseudowissenschaft degeneriert ein Forschungsprogramm, wenn es keine neuen Fakten mehr vorherzusagen vermag.
Wenn man Fibigers Analyse der gegenwärtigen Psychiatrie für zutreffend hält, so wird man wohl oder über zu dem Schluss kommen müssen, dass es sich bei dieser in ihrer gegenwärtigen Form inzwischen um eine Pseudowissenschaft handelt. Thomas Insel, der Direktor des National Institute of Mental Health, der RDoC nach Kräften fördert, darf also durchaus als ein Mensch verstanden werden, der sich als Retter in der Not versucht, der eine Kurskorrektur der Psychiatrie (weg von willkürlichen, auf Mehrheitsmeinungen in Psychiatergremien beruhenden Diagnosen) erzwingen möchte (hin zu einer naturwissenschaftlich fundierten Diagnostik, wie sie heute allgemein in der Medizin üblich ist).
Man sollte nicht vorschnell den Stab über dieses Vorhaben brechen. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass ein konkurrierendes Forschungsprogramm, das psychologisch-sozialwissenschaftliche nämlich, von der biologischen Psychiatrie seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts (mit maßgeblicher Unterstützung durch die Pharmaindustrie) an den Rand gedrängt wurde. Die biologische Psychiatrie muss nun liefern. In einem angemessenen Zeitraum. Im Augenblick jedenfalls richtet sie eindeutig mehr Schaden an, als sie Nutzen zu stiften vermag.
Der gegenwärtigen psychiatrischen Praxis werfe ich vor allem vor,
- dass ihre Aufklärung über die “Schizophrenie”, die “Depression” und eine ganze Reihe anderer Störungen
- bei Betroffenen, Angehörigen, den Medien und ihren Konsumenten nach wie vor den Eindruck hinterlässt,
- dass diese Phänomene auf einem “chemischen Ungleichgewicht”im Hirn beruhten,
- dem durch Medikamente entgegengewirkt werden könnte.
Die Forschung deckt diese These eindeutig nicht. Psychopharmaka haben nicht dieselbe Funktion wie Insulin bei Diabetikern. Wer diesen Eindruck erweckt, führt Menschen in die Irre. Aufklärung über Krankheiten, die in einem demokratischen Rechtsstaat selbstverständliche Pflicht der Mediziner ist, muss unbedingt nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen. Es gibt durchaus berechtigte Gründe, daran zu zweifeln, ob sich Psychiater stets an diesen Grundsatz halten.
The post Die Psychiatrie, die Psychopharmakologie, Enttäuschung, Hoffnung appeared first on Pflasterritzenflora.