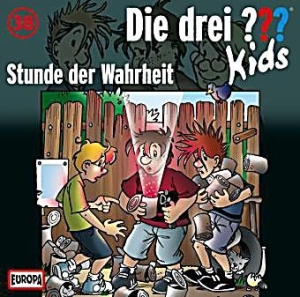Schenkt man den Ergebnissen der berühmten Consumer-Reports-Befragung (1) Glauben, so ist die überwältigende Mehrheit der Psychiatrie-Patienten, die sich einer Psychotherapie unterzogen haben, mit den Ergebnissen zufrieden – und dies unabhängig von der Art des psychotherapeutischen Angebots.
Diese Studie wurde aus methodischen Gründen häufig kritisiert: Sie sei nicht repräsentativ und nur retrospektiv (rückblickend). Diese Einwände sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, dennoch kann ich keinen vernünftigen Grund erkennen, an der generellen Tendenz zu zweifeln.
Die Zufriedenheit mit medikamentöser Behandlung ist nicht so einfach zu beurteilen, da einige dieser Psychopharmaka äußerst unangenehme Wirkungen haben können. Dies gilt insbesondere für die so genannten Antipsychotika (Neuroleptika). Doch selbst bei diesen Substanzen scheint weitgehende Zufriedenheit zu herrschen, wie sich beispielsweise in einer Studie von Gray und Mitarbeitern zeigt (2).
Auch diese und vergleichbare Studien kann man aus methodischen Gründen kritisch betrachten; aber angesichts der großen Zahl freiwilliger Konsumenten von Psychopharmaka aller Arten, die zudem beständig steigt, will ich auch in diesem Bereich an der überwiegenden Zufriedenheit der Psychiatrie-Patienten nicht zweifeln.
Unter den Gründen meiner Psychiatriekritik spielen die unzufriedenen Patienten auch keine herausgehobene Rolle. Diese gibt es zwar auch, natürlich, in den letzten Jahren hatte ich mit Hunderten Kontakt, die sich bitter über die Psychiatrie, über Psychopharmaka, über verständnislose Psychiater, kalte Schwestern und brutale Pfleger beschwerten.
Allerdings bin ich nicht vermessen genug, diese subjektiven Erfahrungen für repräsentativ zu halten. Sie sind naturgemäß selektiv, denn ich bin als Psychiatriekritiker bekannt. Also wenden sich überwiegend Menschen an mich, die sich geschädigt fühlen, wohingegen die dankbaren Patienten mir die kalte Schulter zeigen.
Wenn ich ehrlich sein soll, so erschrecken mich die Berichte der unzufriedenen weitaus weniger als die große, die überwältigende Zahl der zufriedenen Patienten. Wissen wir doch, dass die Effizienz von Psychotherapien vor allem auf dem gemeinsamen Glauben von Therapeuten und Patienten an den Erfolg der Maßnahme beruht und dass die Wirkung der Psychopharmaka entweder überwiegend ein Placeboeffekt ist oder darin besteht, eine mutmaßliche psychische Krankheit durch eine handfeste, reale neurologische Störung zu ersetzen.
Wie kann man damit zufrieden sein? Die Psychiatrie-Patienten bekunden zwar mehrheitlich, dass sie sich, dank der Pillen und der Psychotherapie, besser fühlten, aber an objektiven Maßstäben gemessen lässt sich diese Selbsteinschätzung empirisch nicht erhärten.
Patienten, die dauerhaft mit Neuroleptika therapiert wurden, geht es laut einer neueren Studie mehrheitlich, anhand nachprüfbarer Kriterien beurteilt, sogar schlechter als vergleichbaren Personen, die nicht und nur vorübergehend mit diesen Substanzen behandelt wurden (3).
Es stellt sich also die Frage, wie man die offensichtliche Diskrepanz – zwischen der Zufriedenheit der Psychiatrie-Patienten einerseits und den mageren Befunden der empirischen Forschung zur Effizienz psychiatrischer Leistungen andererseits – beurteilen will.
Nehmen wir einmal an, ein Patient glaube, dank einer Behandlung weniger an seinen “Symptomen” zu leiden als vor Therapiebeginn und zeige sich deswegen zufrieden. Welche Bedeutung hätte diese Zufriedenheit, wenn er nach wie vor arbeitslos, ohne Beziehung, vereinsamt in seiner Absteige sitzen und den ganzen Tag Fernsehen schauen würde? Welche Bedeutung hat die allumfassende Zufriedenheit der Patienten angesichts der Tatsache, dass trotz psychiatrischer Behandlungen mit Psychopharmaka und Psychotherapien die Zahl der angeblich psychisch Kranken beständig steigt?
Es stellt sich also die Frage nach der Validität des Konstrukts der “Zufriedenheit”. Welche Aspekte der Lebensrealität bildet die bekundete Zufriedenheit eigentlich ab? Gibt es objektiv messbare Unterschiede im Leben der eher Unzufrieden, verglichen mit den eher Zufriedenen, die auf die Behandlung zurückgeführt werden könnten. Untersuchungen, die sich mit derartigen Fragen beschäftigen, habe ich bisher vergeblich gesucht.
Die Abschwächung einer “Symptomatik” und die empfundene Verminderung des Leidens sind sicher Werte an sich. Doch genügt das?
Nehmen wir beispielsweise einen Alkoholiker, der nach “erfolgreicher” Therapie abstinent lebt. Er sagt, er sei zufrieden mit seiner Therapie und er leide nicht mehr unter dem Zwang, gleich morgens nach dem Aufstehen schon die Flasche an den Hals zu setzen. Dieser Mensch ist jedoch völlig vereinsamt, weil er seine alten Saufkumpane meiden muss und sich in eine “Trockenleiche” verwandelt hat, der es kaum gelingen will, neue Freunde zu gewinnen. Aber er ist mit seiner Therapie zufrieden; sie ist sogar zu einer Art Religion geworden, mit dem Therapeuten als verehrtem Oberpriester im Mittelpunkt.
Zufriedenheit mit einer misslichen Lage kann durchaus ein Anzeichen stoischer Weisheit sein, sofern sich die Situation nicht ändern lässt, wenn aber eine Chance dazu besteht, dann wäre eine konstruktive Unzufriedenheit vermutlich die angemessenere Gemütsverfassung. Selbst wenn wir einmal voraussetzen wollen, dass psychiatrische Maßnahmen den Behandelten etwas bringen, so wird doch niemand ernsthaft behaupten wollen, sie seien perfekt, und so wäre dann doch wohl eine konstruktive Unzufriedenheit mit ihnen eher ein Qualitätsmerkmal als Zufriedenheit.
Manche meinen, Zufriedenheitsbefragungen würden durch die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten verfälscht. Damit wäre eine Diskrepanz zwischen bekundeter und tatsächlicher Zufriedenheit verbunden. Die Leute würden sich also zufriedener geben, als sie in Wirklichkeit sind. Die Ergebnisse zu diesem Thema, auch was die Zufriedenheit mit psychiatrischen Leistungen betrifft, sind uneinheitlich. Eine durch die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit hervorgerufene Zufriedenheitsbekundung würde mich jedenfalls weniger beunruhigen als eine dadurch nicht verfälschte.
Am 21. Oktober 1949 schrieb Aldous Huxley (Brave New World) an George Orwell (1984) a. u.:
“Within the next generation I believe that the world’s rulers will discover that infant conditioning and narco-hypnosis are more efficient, as instruments of government, than clubs and prisons, and that the lust for power can be just as completely satisfied by suggesting people into loving their servitude as by flogging and kicking them into obedience.”
Huxley mag sich hinsichtlich der Methoden (Konditionierung von Kleinkindern und Narko-Hypnose) zwar geirrt haben, aber dass die Mächtigen den Ohnmächtigen mit immer perfekteren Mitteln zu suggerieren versuchen, ihre Sklaverei zu lieben, daran kann aus meiner Sicht kaum ein Zweifel bestehen.
Und mich beschleicht der Verdacht, dass die Psychiatrie zu jenen Kräften zählen könnte, denen die Verwirklichung dieses Versuchs obliegt. Dafür spricht die Tatsache, dass die Psychiatrie ihre vorgeblichen Ziele, “psychische Krankheiten” zu diagnostizieren und zu heilen oder zu lindern, zwar nicht zu erreichen vermag, sehr wohl aber in großem Maßstab zufriedene Patienten hervorbringt.
Anmerkungen
(1) Consumer Reports. (1995, November). Mental health: Does therapy help? pp. 734-739
(2) Gray, R . et al. (2005). A survey of patient satisfaction with and subjective experiences of treatment with antipsychotic medication. Journal of Advanced Nursing 52(1), 31–37
(3) Wunderink L. et al. (2013). Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 2013 Sep;70(9):913-20
The post Gibt es zufriedene Psychiatrie-Patienten? appeared first on Pflasterritzenflora.