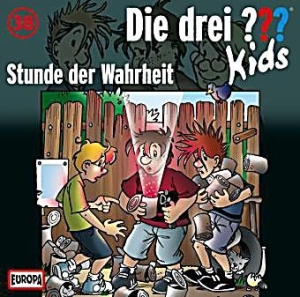Die folgenden Überlegungen sind spekulativ; mir sind keine empirischen Studien bekannt, die sie erhärten; man möge also den folgenden Eintrag als “Thesenpapier” auffassen.
***
Ein Beispiel: Fritz Meyer verliert seinen Job, findet keinen neuen; er macht sich Vorwürfe, bezweifelt, fleißig, engagiert, clever genug gewesen zu sein, glaubt schließlich, er sei gerechtfertigten Ansprüchen im Beruf aus eigenem Verschulden nicht gerecht geworden; er wird “depressiv”; sein Arzt verschreibt ihm Medikamente, die nicht helfen; er leidet fürchterlich; von seiner Frau und seinen Kindern, vor allem von seinen Kindern, verlangt er Rücksichtnahme auf seine Krankheit, was diese heillos überfordert.
Die Moral lastet schwer auf vielen jener Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, die Rolle des “psychisch Kranken” übernehmen. Viele dieser Menschen nehmen die moralischen Gebote und Verbote wesentlich ernster als das Gros ihrer Mitmenschen. Sie empfinden sich als moralische Versager und flüchten sich in die “Krankheit”.
Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um eine “Depression” handeln, um eine Störung, die häufig mit offenen Schuldgefühlen verbunden ist; es kann sich beispielsweise auch eine “Schizophrenie” entwickeln, die mit der Verleugnung der Realität und eine fantastisch-paranoide Umdeutung des Scheiterns einhergeht.
Die Moral fragt nach Normen, nach den Erwartungen generalisierter Anderer, nach dem, was man tut und dem was man nicht tut. Sie fragt nicht danach, wie sich das, was ich tue, in der aktuellen Situation auf mein Gegenüber, auf meinen konkreten Mitmenschen auswirkt. Dafür ist das Gewissen zuständig.
Das Gewissen fragt, ob ich den anderen hier und jetzt ohne Not über Gebühr einschränke, ob ich ihn bei seinen momentanen Aufgaben nach Möglichkeit und Kräften unterstütze, ob er einen gerechten Anteil an den Gütern hat, die in einer Gemeinschaft augenblicklich zur Verfügung stehen etc.
Das Gewissen wurzelt im Biologischen, ist eine anthropologische Konstante, die als eine Voraussetzung der Menschwerdung betrachtet werden darf.
Die Moral ist, gattungsgeschichtlich betrachtet, eine Spätentwicklung; sie ist ein Auswuchs des Ideologischen, also in einer Umdeutung der Wirklichkeitserfahrung im Sinne von Partialinteressen.
Das Gewissen von Menschen, die freiwillig die Rolle des “psychisch Kranken” spielen, ist häufig überaus schwach ausgeprägt. Fritz Meyer trägt schwer an der Last der Moral, aber er kommt nicht auf den Gedanken, sich zu fragen, ob die von ihm wegen seiner Krankheit geforderte Rücksichtnahme fair ist gegenüber seiner Frau und vor allem seinen Kindern. Von ihnen verlangt er, ihre natürlichen Impulse zu unterdrücken, weil er schließlich schwer leide und jedes Geräusch ihm wie Messer ins Gehirn fahre.
Das Gefühl moralischen Versagens lastet schwer auf seiner Seele, aber etwaige Gewissensbisse wegen der konkreten Belastungen, die er seiner Frau und seinen Kindern durch sein Verhalten aufbürdet, beschwichtigt er mit dem Gedanken, dass er schließlich krank und für seine Zustände nicht verantwortlich sei.
Bei dieser Lebenslüge hilft ihm das Märchen vom Serotoninmangel, der angeblich seine “Depression” verursache. Diese “Theorie” ist zwar längst als Marketingschwindel der Pharmaindustrie entlarvt, aber da sie als Legende zur Gewissensentlastung taugt, erfreut sie sich auch bei Betroffenen ungebrochener Beliebtheit.
Dieser Widerspruch zwischen Moral und Gewissen wird verständlich, wenn man bedenkt, dass die Moral dazu tendiert, sich an die Stelle des Gewissens zu setzen, es zu verdrängen. Die Moral knüpft an das Gewissen an, verselbständigt sich ihm gegenüber aber, und zwar in der Regel unbemerkt.
Die Moral ist ein Prozess der Anpassung der Welt des Sollens an die Interessen der Herrschenden, der sich durch die Jahrhunderte zieht. Dieser Prozess wird teilweise auch durch die Ideologen beeinflusst, derer sich die Herrschenden bedienen, um ihre Herrschaft zu verklären; aber im Wesentlichen verläuft er naturwüchsig. Die Imperative des Handelns passen sich, jenseits des Bewusstseins der Menschen, den Herrschaftsstrukturen an.
Da die Moral das Gewissen zu substituieren vermag, fühlt sich Fritz Meyer zwar als Versager, weil seine Arbeitsmoral zu wünschen übrig ließ, nicht aber fühlt er sich als Versager gegenüber seiner Frau und seinen Kindern, die er mit seinen Ansprüchen traktiert. Sein Schuldgefühl gegenüber Frau und Kindern beschwichtigt der Gedanke an seine “Krankheit”; dies gelingt ihm aber nicht in Sachen Arbeitstätigkeit, denn wenn er sich nicht als Versager gegenüber den Forderungen der Arbeitsmoral fühlen würde, dann wäre er ja auch nicht “depressiv”.
Die Psychiatrie ist natürlich eine Komplizin der herrschenden Klasse in diesem Spannungsfeld zwischen Moral und Gewissen.
Natürlich kann man die Regungen des Gewissens auch als Ausdruck einer Moral bezeichnen, als Äußerung einer natürlichen, nicht klassengesellschaftlich deformierten Form der Moral. Um der klareren Abgrenzung willen ziehe ich es aber vor, den Begriff der Moral für Verhaltensregulationen zu reservieren, die sich an abstrakten Werten orientieren, wohingegen das Gewissen sich auf das konkrete Miteinander von Ich und Du bezieht.
Obwohl er keine Abgrenzung zwischen Moral und Gewissen vornimmt, drückt Elisée Reclus in folgenden Zeilen ziemlich genau das aus, was auch ich sagen möchte:
Die offizielle Moral besteht darin, sich vor dem Oberen zu verneigen und sich vor dem Untergebenen stolz aufzurichten. Jeder Mensch muss wie Janus über zwei Gesichter, über zweierlei Arten von Lächeln verfügen: das eine schmeichlerisch, zuvorkommend, manchmal servil, das andere hochmütig und von herablassendem Stolz. Das Prinzip der Autorität – so nennt sich das Ding – erfordert, dass der Obere niemals so aussieht, als ob er Unrecht habe, und dass er bei jedem Wortwechsel das letzte Wort hat. Vor allem aber müssen seine Befehle befolgt werden. Das vereinfacht alles: Es bedarf keiner Erwägungen, keiner Erklärungen, keines Zögerns, keiner Debatten, keiner Bedenken. Die Dinge gehen dann ganz von selbst, schlecht oder gut. Und wenn kein Herr zum Befehlen da ist, hat man für diesen Fall nicht schon fertige Formeln, Verordnungen, Erlasse oder Gesetze, die ebenfalls von unumschränkten Herren oder von Gesetzgebern ausgehen? Diese Formeln ersetzen die unmittelbaren Befehle, und man beobachtet sie, ohne zu untersuchen, ob sie auch der inneren Stimme des Gewissens entsprechen.
Unter Gleichen ist die Aufgabe schwieriger, aber auch vornehmer: Man muss streng die Wahrheit suchen, die persönliche Pflicht entdecken, sich selbst kennenlernen, fortwährend an seiner eigenen Erziehung arbeiten, sich so verhalten, dass die Rechte und Interessen der Genossen respektiert werden. Nur dann wird man ein wirklich moralischer Mensch, gelangt man zum Gefühl seiner Verantwortlichkeit. Die Moral ist nicht ein Befehl, dem man sich unterwirft, eine Parole, die man wiederholt, eine für das Individuum rein äußerliche Sache; sie ist ein Teil des Wesens, ein Produkt des Lebens selbst. So verstehen wir die Moral, wir Anarchisten. Haben wir nicht das Recht, sie mit Genugtuung mit der zu vergleichen, die uns die Vorfahren hinterlassen haben?”
Die Moral der Anarchisten ist das, was ich als Gewissen bezeichne und die “offizielle Moral” gilt mir als Moral schlechthin. Das “Gefühl der Verantwortlichkeit”, das nach Reclus die anarchistische Moral kennzeichnet, ist der dem Moralischen im offiziellen Sinn völlig fremd. Der moralgesteuerte Mensch ist der Verantwortung nämlich de facto enthoben, indem ihm die Moral vorgibt, was zu tun und zu lassen sei. Diese Verantwortungslosigkeit des Moralischen zeigt sich in krasser Ausprägung bei vielen der Menschen, die freiwillig die Rolle des “psychisch Kranken” spielen.
Das Janus-Gesicht vieler dieser Menschen offenbart sich darin, dass sie trotz ihrer “Krankheit” darunter leiden, gegen die Moral der Mächtigen verstoßen zu haben; wohingegen sie ihre Gewissensbisse gegenüber Gleichrangigen bzw. Untergordneten mit Verweis auf ihr pathologisches Leiden die Schärfe nehmen.
Der Mensch, der freiwillig die Rolle des “psychisch Kranken” spielt, ist somit ein vorbildlicher Bürger des Staates. Zwar ist er nicht mehr oder nur noch eingeschränkt produktiv im Wirtschaftsleben, als aktives Subjekt – aber er ist produktiv als passives Objekt der wirtschaftlichen Aktivität von Psychiatrie und Pharmaindustrie und mehrt deren Reichtum. Solche Menschen verdienen es, von der Psychiatrie umsorgt zu werden. Wer allerdings, obwohl dazu ausersehen, die Rolle des “psychisch Kranken” zu spielen sich weigert, den trifft die volle Härte des Systems.
Es gibt natürlich auch Menschen, die zwar den Begriff der “psychischen Krankheit” ablehnen, die aber dennoch jedes Gefühl ihrer Verantwortlichkeit vermissen lassen. Sie spielen die Rolle des “psychisch Kranken”, der kein “psychisch Kranker” sein will.
Die Psychiatrie liebt dieser Menschen gleichermaßen wie die Krankheitseinsichtigen, auch wenn sie, naturgemäß, den entsprechenden Typus mit besonderer, aber “liebender” Strenge behandelt (die erbarmungslos sein kann).
Denn die mit ihrer Verantwortungslosigkeit verbundene Gewissensarmut bringt ihre Mitmenschen gegen diesen Typus auf; und aufgebrachte Mitmenschen werden nur zu gern von der Psychiatrie zur Rechtfertigung ihrer repressiven Maßnahmen instrumentalisiert. Diese “krankheitsuneinsichtigen” Menschen, die in Wirklichkeit nichts begriffen haben, sind ein gefundenes Fressen für die Psychiatrie.
Was die Psychiatrie wirklich schmerzt, sind kritische Psychiatrieerfahrene, die ihren Gemeinschaftssinn vorbildlich in entsprechenden Verbänden oder Vereinigungen, Selbsthilfegruppen oder als streitbare, dem Menschen zugewandte Einzelpersonen entfalten. Sie sind tatsächlich eine Bedrohung für die Psychiatrie, weil ihr Verhalten keinerlei Ähnlichkeiten mehr aufweist mit den Eskapaden von Menschen, die sich als “psychisch Kranke” gerieren. Sie sind die leibhaftige Widerlegung des “medizinischen Modells psychischer Krankheiten”.
The post “Psychisch Kranke”; Moral, Gewissen appeared first on Pflasterritzenflora.