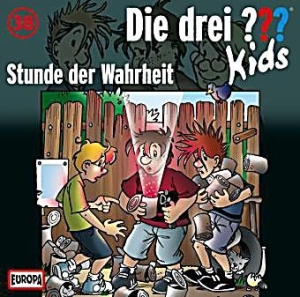Unlängst schrieb mir ein forensischer Diplom-Psychologe, dass er ziemlich leicht erkennen könne, ob ein Mensch an einer Paranoia leide. Wenn ich dies nicht könne, sei ich eine Pappnase. Ich schrieb zurück, ich glaubte ihm, dass er in zehn bis fünfzehn Prozent der Fälle erfolgreich sei, denn nach konservativer Schätzung hätten zehn bis fünfzehn Prozent der Normalbevölkerung regelmäßig Gedanken, die eindeutig die psychiatrischen Kriterien einer “Paranoia” erfüllten (1). Wenn er beanspruche, eine höhere diagnostische Trefferquote als die Zufallstrefferwahrscheinlichkeit zu verzeichnen, so möge er dies beweisen. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Und, um ehrlich zu sein, bin ich darüber auch ganz froh, denn ein Blick auf die Website dieses Menschen überzeugte mich davon, dass sich bei ihm offenbar ein Phänomen zeigt, dass die Psychiatrie bei anderen, nicht also bei ihresgleichen, durchaus als “Größenwahn” einstufen würde. Er spart nicht mit Kritik an der forensischen Psychiatrie, zugleich aber erweckt er den Eindruck, dass man zuverlässig den gefährlichen Paranoiker herausfischen könne, wenn man sich nur an seine Anweisungen hielte und dabei jene Kunstfertigkeit unter Beweis stelle, die ihm (und recht eigentlich: nur ihm) zu eigen sei.
Es versteht sich von selbst, dass er dem Leser statistische Belege für diese steile These schuldig bleibt. Der empirischen Forschung, die sich an die gängigen Methoden hält, scheint er überdies abhold zu sein; er bevorzugt die “Einzelfallanalyse”. Auf welche Weise er dann die Überlegenheit seines Vorgehens erhärten möchte, bleibt sein Geheimnis. Denn am Einzelfall kann man nicht erkennen, ob es sich bei einer richtigen Prognose um einen Zufallstreffer handelte oder eben nicht.
Es ist ja beispielsweise durchaus denkbar, dass ein Mensch weder an einer Paranoia leidet, noch ein inneres Gefährlichkeitspotenzial besitzt und trotzdem, situativ bedingt, eine für ihn untypische Gewalttat begeht. Oder, noch wahrscheinlicher, der Mann hat gut geraten und einen aus den zehn bis 15 Prozent der Leute mit Paranoia erwischt, die zudem noch gewalttätig sind (eine verschwindend kleine Zahl). Schließlich findet ein blindes Huhn – im Einzelfall – auch einmal ein Korn.
Während die “Paranoia” mehr oder weniger normal ist, sind von “Paranoiden” begangene Gewalttaten überaus seltene Ereignisse. Und wie so oft bei seltenen Ereignissen fehlt uns bei diesen die solide empirische Basis für wissenschaftlich halbwegs vertretbare Prognosen. Dies führt zwangsläufig dazu, dass viele Harmlose als gefährlich erachtet und viele Gefährliche als harmlos eingestuft werden. Wenn es einen biologischen Mechanismus für psychogene Gewalt gäbe und wenn wir diesen zuverlässig feststellen könnten, sähe die Sache natürlich anders aus. Aber wir kennen ihn nicht und vielleicht gibt es ihn auch gar nicht, weil die überwiegende Mehrheit der rätselhaften, rational nicht erklärbaren Gewalttaten situativ bedingt sein und nicht auf persönlichen Faktoren beruhen könnte.
Was ist eigentlich “Paranoia”? Die Psychiatrie sagt: Paranoid ist einer, der unverbrüchlich an einer Überzeugung festhält, obwohl sie erwiesenenermaßen falsch ist bzw. von der überwältigenden Mehrheit seines Umfelds für bizarr und abwegig gehalten wird. Nicht paranoid jedoch sind selbst falsche Überzeugungen dann, wenn auch die primäre Bezugsgruppe des Betroffenen daran glaubt (zum Beispiel religiöse Glaubenslehren). Was die Psychiatrie sagt, deckt sich weitgehend mit dem so genannten gesunden Menschenverstand. Aus diesem Grund ist es so verteufelt schwierig, mit Aussicht auf Erfolg dagegen zu argumentieren.
Auch wenn Sie nicht paranoid sein sollten, lieber Leser, wird es ihnen schwerfallen, die meisten Ihrer Überzeugungen zu beweisen. Sie werden auch keine Kirche finden, die alle dieser unbeweisbaren Überzeugungen mit Ihnen teilt. Sie müssten schon Ihre eigene Kirche gründen, die alle Ihre Überzeugungen zur Glaubenslehre erklärt und selbst dann brauchten Sie auch noch Kirchenmitglieder in nennenswerter Zahl. Sie werden vielleicht argumentieren, dass auch Ihre unbeweisbaren Überzeugungen kein Wahn, sondern allenfalls und möglicherweise ein Irrtum seien. Und wenn sie dennoch, also auch im Falle eines Irrtums, unverbrüchlich daran festhielten, so sei dies kein Symptom einer psychischen Erkrankung, sondern der Tatsache geschuldet, dass man lieb gewonnene Überzeugungen nicht mir nichts dir nichts über Bord werfe.
Sicher, natürlich. Aber erklären Sie dies einmal einem forensischen Diagnostiker wie dem oben erwähnten, wenn es hart auf hart kommt. Sie haben keine Chance, weil diese Leute den Unterschied zwischen Irrtum und Paranoia nicht gelten lassen, wenn Sie ihrem Vorurteil entsprechen. Sie lieben den Wahn, weil man ihn nicht beweisen kann. Beweisen kann man bestenfalls den Irrtum, nicht aber den Wahn, denn dieser ist eine subjektive Meinung. Der Wahn unterstellt eine “psychische Krankheit” und alle Versuche, die Existenz solcher Krankheiten zu beweisen, sind bisher fehlgeschlagen.
Gäbe es physiologische Grundlagen der “Paranoia” und psychogener Gefährlichkeit und ließen diese sich feststellen, dann könnte man zuverlässig vor Gericht entscheiden, ob jemand in den Knast oder in die Klapse muss. Doch da solche Mechanismen nicht bekannt sind, eröffnet sich eine weite Seelandschaft für die Zünfte der forensischen Psychiatrie und Psychologie, wo man weitgehend unbehelligt im Trüben fischen darf und muss, solange man nur schlussendlich die richtigen an der Angel hat, also jene, die der jeweilige Richter gern auf unbestimmte Zeit hinter psychiatrischen Gittern wissen möchte.
Die “Paranoia” ist eine schöne Sache, denn der “gesunde Menschenverstand” hält die Paranoiden unverbrüchlich und unverrückbar für besonders gefährlich, obwohl sie dies erwiesenermaßen nicht sind. Psychiatrisch betrachtet müsste man dies also als paranoiden Zug im gesunden Menschenverstand identifizieren; aber das erste, was man im Umgang mit der Psychiatrie zu lernen hat, besteht darin zu erkennen, dass sie ihre Prinzipien sehr selektiv anwendet. Was also bei dem einen als Symptom einer Paranoia gewertet wird, gilt bei dem anderen als Anzeichen eines klaren Durchblicks. Darum ist der, der sich mehr vor Paranoiden fürchtet als vor anderen Menschen, eindeutig nicht paranoid.
Besonders scharfe Kritiker der Psychiatrie meinen, diese sei selbst eine Form der institutionalisierten Paranoia. Jeder, der von der Norm abweiche und dafür keine Entschuldigung vorbringen könne, die auch Kleingeistern einleuchte, werde verdächtigt, “psychisch krank” zu sein und sich eventuell selbst oder andere zu gefährden. Doch laut psychiatrischer Doktrin ist eine Paranoia nicht durch soziale, ökonomische oder kulturelle Faktoren zu erklären. Bei der Psychiatrie aber sind wesentliche Ursachen offensichtlich, nämlich das Streben nach Geld und Sicherheit. Daraus folgt, dass es sich bei der Psychiatrie nicht um institutionalisierte Paranoia handeln kann.
Das Schöne an der Paranoia ist auch, dass man sie mühelos künstlich hervorrufen kann, wenn danach Bedarf besteht. Man sperre einen beliebigen Menschen zur Beobachtung in einer Klapsmühle ein. Schon bald wird er ängstliches oder aggressives Misstrauen gegenüber dem Personal entwickeln und sich womöglich als Opfer einer Verschwörung empfinden. Und schon ist er paranoid; gut nur, dass er rechtzeitig weggesperrt wurde. Auch eine Familie, die den lästigen Opa, beispielsweise, loswerden möchte, hat keine Schwierigkeiten damit, diesen in einen Zustand der Paranoia zu versetzen. Nach außen liebevolle Sorge, nach innen Schikane – und der Opa ist reif für die Anstalt. So einfach geht das.
Angriff ist die beste Verteidigung. Nur Mut. Erklären Sie andere für paranoid, bevor diese das mit Ihnen tun. Merken Sie denn gar nicht, dass diese nur noch auf einen günstigen Augenblick warten. Kommen sie denen, die Ihnen eine Paranoia unterstellen wollen, möglichst schnell zuvor. Vergeuden Sie keine Zeit und lassen Sie sich durch die freundliche Fassade nicht täuschen: Die sind hinter Ihnen her. Drehen Sie den Spieß um. Der Psychiatrie ist es egal, wen sie für paranoid erklärt. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Anmerkung
(1) Freeman, D. (2007). Suspicious Minds: The Psychology of Persecutory Delusions. Clinical Psychology Review, 27, 4, 425-427
The post Paranoia appeared first on Pflasterritzenflora.